Erinnern und mahnen – Danke an Vlore (ELTERN GEGEN RECHTS)
Wir dokumentieren die Rede von Vlore auf unserer Kundgebung am Denkmal für die ermordeten Juden Europas am 26.4.2025 und sagen DANKE.
Wir stehen heute an einem bedeutenden Denkmal.
Ein Ort der Erinnerung.
Und ich möchte heute drei Menschen in unser kollektives Gedächtnis zurückholen –
Menschen, die zu oft übersehen oder längst vergessen sind.
Der erste Mensch, an den ich erinnern möchte, ist Hugo Bettauer.
Der jüdische Schriftsteller veröffentlichte 1922 seinen dystopischen Roman:
„Die Stadt ohne Juden“ –
eine bitterböse Satire über den Antisemitismus seiner Zeit.
Darin lässt ein fiktiver Politiker alle Jüdinnen und Juden aus Wien vertreiben.
Nur drei Jahre später, 1925, wurde Bettauer ermordet.
Nach wochenlanger Hetze in der Presse.
Von einem NSDAP-Mitglied: Otto Rothstock.
Mit einem einzigen Schuss.
Ein Mord – begangen im Namen der sogenannten „Moral“.
Rothstock wurde verhaftet.
Doch das Gericht erklärte ihn –
auf Empfehlung seines nationalsozialistischen Anwalts –
für „geisteskrank“.
Nach nur 20 Monaten verließ er die Psychiatrie.
„Geheilt“.
Von Spenden aus der Bevölkerung unterstützt.
Jahrzehnte später –
in einem Fernsehinterview –
brüstete sich Rothstock noch mit Bettauers Ermordung.
Kein Wort der Reue.
Kein Funken von Scham.
So früh begann der Terror.
So spät – endete er nie wirklich.
Der zweite Mensch, an den ich heute erinnern möchte, ist vielleicht einigen von Euch bekannt:
Artur Landsberger.
Ein Berliner Jude.
Ein Autor.
Ein unbequemer Geist.
Einer, der die Elite seiner Zeit mit scharfer Feder entlarvte.
In den 1920er-Jahren verschrien als „Gossenliterat“.
Geliebt vom Volk.
Verachtet von den oberen Zehntausend.
1925 – im selben Jahr wie Bettauers Ermordung
und der Veröffentlichung von Hitlers „Mein Kampf“ –
erschien Landsbergers Roman: „Berlin ohne Juden“.
Darin stellt er sich eine Hauptstadt vor,
aus der alle jüdischen Menschen verbannt wurden.
Was bleibt?
Leere.
Verlust.
Verödung.
Er erkannte früh:
Die jüdische Bevölkerung war tief verwoben
mit dem kulturellen und intellektuellen Leben dieser Stadt.
Ihre Auslöschung war nicht nur Unrecht –
sie war ein Angriff auf das Wesen Berlins selbst.
Landsberger hatte keinen Plan B.
Dafür liebte er Deutschland zu sehr.
Wie dieses Zitat aus dem Vorwort zu „Berlin ohne Juden“ belegt:
„Denn das tragische Schicksal (m)eines Vaterlandes machte mich nicht zu einem armen – darauf pfeif’ ich –,
sondern auch zu einem einsamen und unglücklichen Menschen.
Das Tragen dieses Schmerzes aber erscheint mir als Maßstab für den Patriotismus eines Menschen
zuverlässiger als das Tragen von Hakenkreuzen und das Absingen patriotischer Lieder.“
Am 4. Oktober 1933 nahm sich Artur Landsberger das Leben.
Er erlebte nicht mehr,
wie seine Dystopie bittere Realität wurde.
1940 erschien das „Lexikon der Juden in der Musik“ –
ein erschreckendes Dokument systematischer Auslöschung jüdischer Kultur.
Viele der darin genannten Namen –
waren Menschen, die Landsberger einst literarisch in seiner Dystopie verarbeitet hatte.
Der dritte Mensch, an den ich heute erinnern möchte,
war ein Freund meiner Familie:
Sadri Berisha.
Ich war zwölf Jahre alt.
In der Nacht zum 8. Juli 1992
wurde Sadri Berisha – ein 55-jähriger Kosovo-Albaner, Muslim, Gastarbeiter –
im Schlaf von Neonazis erschlagen.
Mit einem Baseballschläger.
Zwei Schläge auf den Hinterkopf.
In Kemnat bei Stuttgart.
Er hatte niemandem etwas getan.
Er war einfach nur da.
Sadri war ein Freund meines Vaters.
Ich habe diesen Teil unserer Familiengeschichte lange verdrängt.
Vielleicht, weil die Asylheime brannten.
Vielleicht, weil ich zu jung war.
Vielleicht, weil wir geglaubt haben –
es würde irgendwann besser werden.
Heute beginnt die nächste Generation meiner Familie in Deutschland zu leben.
Meine Nichte ist mit ihren zwei Kindern ins Ruhrgebiet gezogen.
Die Kinder sind 7 und 9 Jahre alt.
Sie sprechen kaum Deutsch.
Aber sie sind da.
So wie Sadri einst da war.
So wie ich da war.
So wie wir alle hier sind.
Und wieder frage ich mich:
Wie konnte passieren, was passiert ist?
Heute weiß ich:
Mit unserem Schweigen machen wir uns zu Mittäterinnen und Mittätern.
Es gibt keine Grauzone.
Es gibt keine Neutralität.
Es gibt Faschisten –
und es gibt Antifaschisten.
Dazwischen gibt es nichts.
Wir sind heute hier,
weil wir uns entschieden haben.
Weil wir laut sind.
Weil wir erinnern.
Und weil wir handeln wollen.
Für Hugo.
Für Artur.
Für Sadri.
Für unsere Kinder.
Für unsere Demokratie.
Für eine Zukunft,
in der niemand mehr Angst haben muss,
weil er oder sie „anders“ ist.
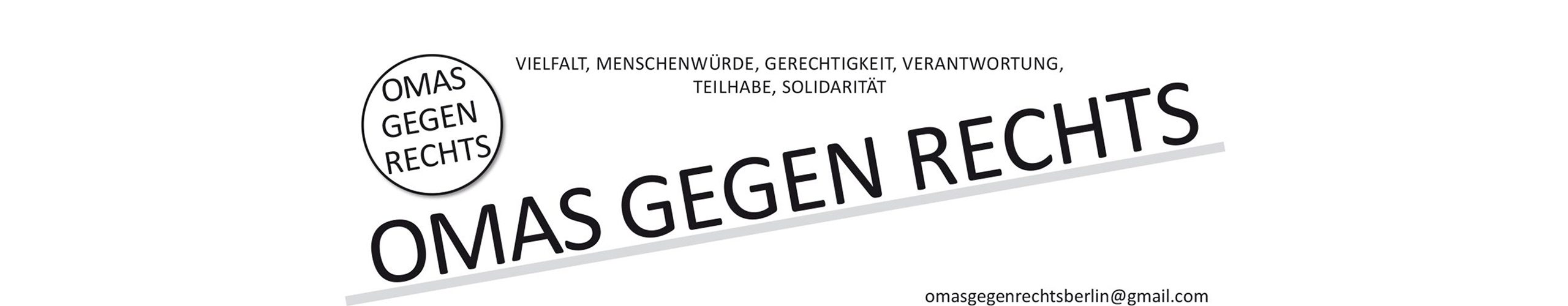

Neueste Kommentare